Willkommen beim Arbeitskreis Wissenschaftskritik
Rede es AK Wissenschaftskritik zum March for Science am 22. April 2017
Ich begrüße Sie alle herzlich im Namen der Arbeitskreises Wissenschaftskritik
& kritische Wissenschaft des Studierendenrates. Dieser Arbeitskreis
wurde vom StuRa aus der Not heraus eingerichtet, dass die Studierenden die
neoliberale Vereinnahmung der Wissenschaft, mit immer größer werdendem
Unbehagen erlebt haben. Wir sind engagierte, kritische Studierende, die sich
über die Verantwortung von Wissenschaft in der Gesellschaft Gedanken machen.
Auch wir erklären uns solidarisch mit allen, die es in der akademischen
Welt mit zunehmend autoritärem Gegenwind zu tun haben. Ebenso ist es
wichtig ein Zeichen gegen den grassierenden Rechtsruck zu setzen. Eine
entscheidende Chance verpasst der March for Science jedoch, wenn er nicht
die Wissenschaft selbst hinterfragt in ihren gesellschaftlichen Funktionen
als Wissensproduzent, Politikberater, Innovations- und Wachstumsmotor,
Bildungsstätte und Arbeitgeber zugleich.
Es wird nämlich vergessen, unter welchen Bedingungen und in wessen Interesse
Wissenschaft betrieben wird. Dies hatte in den letzten Jahrzehnten auch eine
gravierende Wirkung darauf, dass die Wissenschaft in der Gesamtbevölkerung
zunehmend mit Skepsis betrachtet wird und in eine Legitimationskrise
geraten ist.
Zuallererst haben es Wissenschaftler*innen lange genug versäumt, sich
inmitten der Gesellschaft zu verorten. Sie haben mal bewusst mal unbewusst
ausgeblendet, dass sie selbst das Produkt der herrschenden historischen
Verhältnisse sind und ihr Tun und Handeln immer in einer Wechselwirkung mit
den gesellschaftlichen Zusammenhängen steht und politische Auswirkungen
hat. Sie haben versucht, sich der politischen Verantwortung unter dem
Vorwand einer Pseudo-Objektivitität zu entziehen, zu einer offenen und
emanzipierten Gesellschaft beizutragen. Stattdessen agierten sie aus einem
weiß-männlich-mittelschicht-dominierten Elfenbeinturm heraus.
Nun sind die meisten überrascht davon, dass die Kapitalinteressen sich
auch gegen die Wissenschaft wenden können, von denen sie so lange gezehrt
hat. Das ist nämlich gerade das, was in Trumps Amerika passiert: Forschungen
über Klimawandel und erneuerbare Energien zeigten sich nicht vereinbar mit
den Interessen der amerikanischen Auto-Industrie. Und Überraschung! die
Gelder wurden gestrichen. Sozialwissenschaften, insbesondere Gender-Studies
gelangen an unbequeme Erkenntnisse, durch die Frauen und Minderheiten schwerer
kontrollierbar werden und schon werden die Gelder gestrichen. Offensichtlich
kommt das alles nicht aus reiner Bosheit oder Dummheit zu Stande; im
Gegenteil aus einem Kalkül heraus, die national-kapitalistischen Interessen
zu verteidigen.
In Deutschland ist die Gefahr noch nicht so akut wie in den USA, jedoch
heimtückischer. Die Finanzierung durch die öffentliche Hand wird
immer mehr demokratisch unkontrollierbaren Strukturen wie Unternehmen
überlassen. Militärforschung und die Ablehnung von Zivilklauseln an
Hochschulen zeigen bei parallel ablaufender Sparpolitik und Kürzungen
für Bildung, Gesundheit und Ökologie was höher bewertet wird. Die
Drittmittelabhängigkeit macht die Wissenschaft immer markt- und
konkurrenzorientierter. Dies schlägt sich auch in der Qualität
von Forschungsarbeiten aus, in der Dinge wie p-value-fishing und
„Politur“ von Ergebnissen zum Standard gehören, was heute in einer
Replizierbarkeitskrise mündet. Gewisse, nicht rentable Strömungen wie
beispielsweise in Wirtschaftswissenschaften oder Psychologie werden an den Rand
gedrängt. Durch die nichtöffentliche Struktur der Hochschulräte versucht
der Markt die Wissenschaft viel direkter zu beeinflussen. Die studentischen
Mitbestimmungsrechte werden dagegen immer mehr eingeschränkt. Selbst das
Studium wurde unter der Bologna-Reform markthöriger, während die Qualität
der Lehre und die Förderung kritischen Denkens enorm darunter gelitten
haben. Die Arbeitsbedingungen für wissenschaftliches Personal, insbesondere
im Mittelbau sind durch befristete Arbeitsverträge, Leistungszwänge und
Unvereinbarkeit von Familie und Karriere besonders prekär. Unter diesen
Umständen können wir schon lange nicht mehr von der Freiheit der Forschung
reden und sollten uns fragen, inwiefern die vielfach gepriesenen Werte der
Wissenschaft, für die wir heute hier stehen, überhaupt noch eingehalten
werden.
Wir begrüßen diese Demo heute daher mit Vorbehalt. Der Marsch lenkt nämlich
von einigen wichtigen Themen ab. Bildung ist heutzutage mehr Privileg als
Recht Die Überheblichkeit bildungsnaher Schichten gegenüber bildungsfernen
ist Ausdruck einer bequemen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das
wird konkret vor Augen geführt, wenn die AfD sich als Professorenpartei
labelt, von der die größten Anfeindungen gegen die Wissenschaft zu
erwarten sind. Auch die traditionelle Nähe elitärer Burschenschaften zu
den Universitäten mit ihrem Frauen und Ausländer ausschließendem Charakter
schlägt sich in der Akademie immer noch mit sexistischen Professor*innen und
dem geringen Anteil der Professorinnen und Menschen mit Migrationsgeschichte
nieder. Wer überhaupt Zugang zur Wissenschaft und Hochschulbildung hat,
wird bereits schon in der Schule durch klassistische und oft rassistische
Ausschlüsse vorbestimmt. Bildung ist in allen Ebenen so konzipiert, dass
die Privilegien bestimmter Gruppen erhalten bleiben.
Die Rolle der Wissenschaft bei der Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit
wird nicht hinterfragt, da diese hier auch leider nicht zur Diskussion
steht. Wir sollten daher aufpassen, dass der March for Science als Antwort
auf die zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit nicht missverstanden wird. Dass
die Wissenschaft in der Bevölkerung zunehmend an Glaubwürdigkeit verliert,
liegt nicht daran, dass eine Argumentation oder Herleitung nicht geteilt
würde. Der Grund dafür ist vielmehr, dass sie von wirtschaftlich und
politisch Abgehängten als Teil des Establishments gesehen wird, ein Bereich,
der für die normale Bevölkerung unzugänglich ist und demnach auch nicht
in ihrem Interesse handelt. Eine Demonstration für die Wissenschaft kann
somit leicht als Demonstration für den eigenen Statuserhalt verstanden
werden, die das Problem überall, aber nicht bei sich selbst sucht. Dass
sich die Wissenschaft erst jetzt zu Wort meldet, wo die Legitimität der
Eliten zunehmend in Frage gestellt wird, bestärkt diesen Eindruck nur.
Wir freuen uns über alle Menschen, die sich für dieses Thema engagieren und
sich den öffentlichen Raum nehmen; begreifen aber die Krise, mit der sich
die Wissenschaft konfrontiert sieht, als Teil einer umfassenderen politischen
Krise. Das neoliberale Saatgut, welches Anfang der 70er gepflanzt wurde,
ist nach der Finanzkrise 2008 zu einer immer größeren politischen Krise
herangewachsen.
Wenn die Wissenschaft in Zukunft glaubwürdig bleiben will und für die Werte stehen will, für die sie heute demonstriert, sollte sie auch vermehrt einen kritischen Blick auf sich selbst richten, sich auf ihre eigenen Werte wie Diskussionskultur, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und kritisches Denken zurückbesinnen und sich fragen, inwiefern sie selbst zur Ursache dieser Krise beigetragen hat. Wenn wir von einer freien und demokratischen Wissenschaft sprechen wollen, müssen wir deutlich machen, dass wir nicht vom freien Zugriff der Märkte auf die Wissenschaft sprechen wollen, sondern vom freien Zugang der Gesellschaft zur Wissenschaft!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Völkisch, reaktionär und elitär – das hochschulpolitische Programm der AfD
Vortrag von Christian Schaft
Donnerstag, 01.12.2016, 18.00 – 20.00 Uhr, Hörsaal 4, Carl-Zeiss-Straße 3
Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) längst ein manifester Bestandteil des politischen Alltags geworden und gerät immer wieder vor allem durch ihre mal verblümt, mal offen vorgetragenen rassistischen Forderungen zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in die öffentliche Debatte. Es ist wohl gelebte Realsatire, dass ihre prominenten Vertreter*innen die übrigen Parteien regelmäßig als »Altparteien« abkanzeln. Denn wirft man einen Blick auf die AfD offenbaren sich schnell deren Ansätze als vorgestrig. Sie propagieren eine heilsversprechende neoliberale Wirtschaftspolitik der 80er Jahre, eine Frauen- und Familienpolitik der 60er Jahre und eine Gesellschafts- und Nationalstaatspolitik, die an die Anfänge des letzten Jahrhunderts erinnert. Auch ihre Vorstellungen im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftspolitik zeugen von einem mangelnden Verständnis der aktuellen Herausforderungen im Bildungs- und Hochschulsystem und erinnern an die Restaurierung der alten Ordinarienuniversität. Drei Leitlinien prägen sowohl das AfD-Grundsatzprogramm als auch die Initiativen verschiedener Landtagsfraktionen:
- ein autoritäres und elitäres Bildungsverständnis
- eine Elitenbildung die ethnisch bestimmt wird und
- ein ideologischer Feldzug gegen kritische Geistes- und Sozialwissenschaften – allen voran das Gender-Mainstreaming.
In der Veranstaltung wollen wir der Frage nachgehen, wie gefährlich die AfD, ihre Ideologie und ihre braunen Netzwerke für die Hochschullandschaft sind. In der anschließenden offenen Gesprächsrunde soll dies im Kontext bestehender hochschulpolitischer Problematiken diskutiert und kontextualisiert werden.
Tagung „Umkämpfte Objektivitäten“
Call for Papers
Der Arbeitskreis Wissenschaftskritik & kritische Wissenschaft des StuRa (FSU Jena) organisiert vom 03.–05.06.2016 eine studentische Tagung, um die Möglichkeiten kritischer Perspektiven in der Wissenschaft auszuloten.
Die auf Leistung und Konkurrenz ausgerichtete Bologna-Universität hemmt durch ihre inhaltlichen und strukturellen Vorgaben die Kritikfähigkeit und Aktivität vieler Studierender und vernachlässigt Forschungsfelder, die als nicht attraktiv für Drittmittelprojekte gelten. Für den Blick über den Tellerrand – sei es durch interdisziplinäres Interesse, methodenkritisches Denken oder sozial orientiertes Handeln – bleibt häufig keine Zeit (und kein Geld). Doch genau solche Menschen suchen wir: Student*innen und Absolvent*innen, die den herrschenden wissenschaftlichen Diskursen und deren naturalisierenden, androzentrischen, eurozentrischen, verdinglichenden und affirmativen Tendenzen mit Zweifel begegnen und ihr emanzipatorisches Denken in ihre (Abschluss-)arbeiten einbringen.
Gemeinsam mit euch wollen wir Perspektiven in der kritischen Wissenschaft und Möglichkeiten, sinnvolle Beiträge in der Gesellschaft zu leisten, erforschen. In der Tagung gehen wir dem Ziel nach, den (un-)bewusst aus der neoliberalen Hochschule hinausgeschriebenen Denk- und Sichtweisen (wieder) mehr Raum zu geben und sichtbar zu machen. Hierzu werden wir euch in Panels, Diskussionen, Workshops und Vorträgen eine Plattform bieten, um untereinander und mit Vertreter*innen aus verschiedenen Disziplinen in Kontakt zu treten.
Wenn du denkst, dass deine Abschlussarbeit (fertig oder im Entstehen) in der einen oder anderen Hinsicht zu der Tagung passt und du darüber mit ähnlich Gesinnten aus deinem oder anderen Fachbereichen zu einem Austausch kommen willst, dann schick uns bitte *bis zum 24.04.2016 ein Exposé/Abstract* von deiner Abschlussarbeit, in welchem du insbesondere die kritischen Aspekte deiner Arbeit hervorhebst. (Länge 1 bis 2 A4 Seiten ggf. mit Bildmaterial etc.) Die Arbeiten werden bei der Tagung in einem max. 25-min. Vortrag oder alternativ innerhalb einer Postersession vorgestellt, um anschließend mit den Anwesenden diskutiert zu werden. Da die Teilnehmenden aus diversen Fachgebieten kommen, bitten wir dich, eine fachübergreifend verständliche Sprache zu verwenden.
Neben deiner Einsendung des Exposés/Abstracts und der Vorbereitung deines Vortrags oder Posters sind keinerlei Teilnahmevoraussetzungen gegeben. Schick uns einfach die Dokumente per Mail und stell dich bei dieser Gelegenheit kurz vor:
- Studienfach oder -fächer
- (voraussichtliches) Abschlussdatum
- Exposé/Abstract, aus dem der Bezug zur Tagung hervorgeht
- evtl. Bildmaterial
- Angabe, ob du einen Vortrag halten oder an der Postersession teilnehmen willst
Student*innen aller Fachrichtungen (auch Naturwissenschaften!) sind herzlich dazu eingeladen teilzunehmen und mit uns in Kontakt zu treten.
Fahrtkosten können vollständig oder zum Teil erstattet werden. Schlafplätze können gestellt werden. Bei Kinderbetreuungsbedarf kontaktiere uns bitte so früh wie möglich.
Alle Unterlagen, Fragen & Anregungen bitte an: umkaempfteobjektivitaeten [at] gmail.com
Für weitere Informationen: http://umkaempfteobjektivitaeten.stura-jena.de"
Wissen und Kritik?
Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftskritik und kritischer Wissenschaft
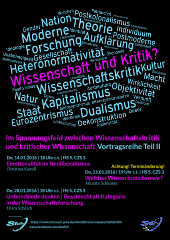
Die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft und Kritik?“ Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftskritik und kritischer Wissenschaft“ geht mit dem Teil II weiter. Dieses Mal haben wir folgende Veranstaltungen für Euch zusammengestellt:
Donnerstag, 14.01.2016, 18.00 Uhr Hörsaal 5:
Christina Kaindl: „Emotionalität im Neoliberalismus“
Emotionen werden im Alltagsverständnis als das Gegenteil von Rationalität verstanden, auf der anderen Seite wird im Neoliberalismus daraus gerne Kapital geschlagen. Auch traditionelle Psychologie betrachtet Emotionen eher als Störfaktoren. Doch in Kritischer Psychologie wird Emotionen einen erkenntnis- und handlungsleitenden Wert beigemessen und damit eine komplett andere Perspektive eröffnet. In der Veranstaltung wird untersucht, welche Rolle Emotionen in unterschiedlichen Phasen des Kapitalismus, durch veränderte Anforderungen in Arbeit, Produktion, Beziehungen zugeschrieben werden.
Christina Kaindl, Diplom-Psychologin, promoviert in Politikwissenschaften an der FU Berlin zum Zusammenhang von Neoliberalismus und Rechtsextremismus. Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Das Argument. Schwerpunkt in Fragen des Zusammenhangs von Politik und Wissenschaft, Wissenschaftskritik, Rechtsextremismus, Antifaschismus, Kritische Psychologie
Donnerstag, 21.01.2016, 19.00 Uhr Hörsaal 5:
Annette Schlemm: „Welches Wissen brauchen wir?“
Von Kindheit an bekommen wir Wissen eingetrichtert. Und dann ist weiter „lebenslanges Lernen“
angesagt, um mitreden und -machen zu können im gesellschaftlichen Leben. Was da zu lernen ist,
hängt von der Gesellschaft ab. Wenn wir kritisch zur herrschenden(!) Gesellschaft stehen, was
gibt es da für uns zu lernen oder zu wissen?
Darum geht es im Workshop mit Annette Schlemm (die als Physikerin und Philosophin durchaus einiges
lernen musste und immer noch begeistert tut). Weil Ihr nicht bloß ein Referat zu hören bekommt,
wäre es schön, wenn die meisten etwas auf folgende Fragen antworten könnten (stichpunkthaft reicht):
- Wozu überhaupt Wissen? (Welches Wissen brauchen wir wirklich?)
- Welche Art Wissen aus der heutigen Zeit brauchen wir nicht?
- Wie kommen wir zu dem Wissen, das wir brauchen?
Dr. Annette Schlemm, Physikerin und Philosophin, Buchautorin, arbeitet zu Themen wie Anwendung der Selbstorganisationskonzepte, Chaostheorie, System- und Gesetzesbegriff, Dialektik (bes. Klassische deutsche Philosophie), Erkenntnistheorie, Mensch-Natur-Verhältnis und globale Probleme der Menschheit.
Donnerstag, 28.01.2016, 18.00 Uhr Hörsaal 5:
Elvira Scheich:
„Unterschiede denken - Geschlecht als Kategorie in der Wissenschaftsforschung“
In diesem Vortrag werden Impulse aufgegriffen, die von einem relationalen Verständnis der Geschlechterdifferenz für das theoretische Denken ausgehen. Insbesondere sollen diese Ansätze entwickelt werden im Hinblick auf Naturerkenntnis sowie auf die Perspektiven, unter denen diese in verschiedenen Wissenschaften gefasst werden. Daraus lassen sich Elemente einer kritischen Wissenschaftsforschung benennen, die nachdrücklich Bezug nimmt auf die gesellschaftlichen (Natur-)Verhältnisse und deren hybride Verfasstheit zwischen Globalität und Lokalität.
Prof. Dr. Elvira Scheich leitet die AG Scheich im Fachbereich Physik an der Freien Universität Berlin, die sich in Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie in der Physik unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterforschung spezialisiert.
Die Referentin Prof. Dr. Elvira Scheich musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wir möchten aber trotzdem das Thema feministische (Natur-)Wissenschaftskritik mit euch gemeinsam angehen und ins Gespräch kommen. Deswegen bieten wir statt des Vortrags „Unterschiede denken – Geschlecht als Kategorie in der Wissenschaftsforschung“ einen Workshop zum selben Thema an.
Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, die Diskussion in einer gemütlichen Kneipenatmosphäre weiterzuführen. Bitte kommt auf uns zu, wenn Ihr Interesse habt.
Wissen und Kritik?
Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftskritik und kritischer Wissenschaft
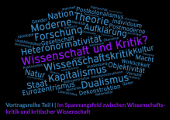
Wir möchten euch auf unsere kommenden Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Wissen und Kritik? – Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftskritik und kritischer Wissenschaft“ hinweisen:
Mittwoch, 02.12.2015, 18.00 Uhr Hörsaal 4:
Eske Bockelmann: „Exakte Unwahrheit“
Wissenschaft trennt sich ab von dem, was Wissen heißt, als sie exakt wird. Das ist im 17. Jahrhundert die Folge eines beispiellos tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, des Übergangs in unsere geldvermittelte Wirtschaft. Denn diese erzwingt eine in sich unwahre Form des Denkens, die sich aller Wissenschaft einbeschreibt – mit unabsehbaren Folgen.
Mittwoch, 09.12.2015, 18.00 Uhr Hörsaal 6:
Alex Demirović: „Wissenschaft oder Dummheit“
Die Bildung wurde in den letzten Jahren zunehmend neoliberal ausgerichtet. Die Kritik daran bezieht sich meist auf den Abbau demokratischer Teilhabemöglichkeiten. Aus dem Blick gerät dabei oft, welche Konsequenzen der Wettbewerb von Bildungsinstitutionen untereinander auf die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion selbst hat.
Geplant ist zudem, die Reihe im Januar fortzuführen.
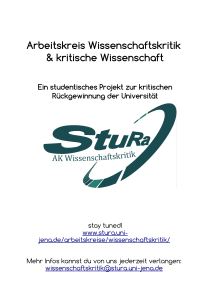
Arbeitskreistreffen
Der Arbeitskreis Wissenschaftskritik trifft sich am Mittwoch, dem 28.10.2015 um 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten des StuRa.
Gründung des AK Wissenschaftskritik
Vor Kurzem hat der StuRa den Arbeitskreis Wissenschaftskritik eingerichtet.
Die Idee dahinter ist, dass im universitären Rahmen die abweichenden Standpunkte gegenüber dem „Mainstream“ der Wissenschaften zu kurz kommen bzw. absichtlich (oder aus „Sachzwängen“) ausgeblendet werden. Wir wollen hier genauer hinschauen, was die Gründe dafür sind.
Was also soll an der Wissenschaft kritisiert werden, die sich doch eigentlich mal auf die Fahne geschrieben hat, kritisch zu sein bzw. sich durch Kritik weiter voranzubringen? Warum gibt es etliche Teildisziplinen innerhalb einzelner Fachbereiche, die sich diesen Zielen bereits verschrieben haben. Beispielsweise sind zu nennen kritische Soziologie, kritische Psychologien, kritische Geschichte, kritische Politikwissenschaft oder kritische Herangehensweisen in Wirtschaftswissenschaften über Pädagogik bis hin zu den Naturwissenschaften oder der Mathematik? Gemeinsam wollen wir die impliziten Grundannahmen der Mainstreamwissenschaften hinterfragen, ihre Motive erarbeiten und ihre Positionen und die Kontroversen, in denen sie in ihren Disziplinen verstrickt sind, diskutieren. Lasst uns einen Raum eröffnen, in dem wir Einblick darin bekommen können, was aus der neoliberalen Hochschule ausgeschlossen wird.
Doch der Arbeitskreis ist neu und kann nur durch Eure Verstärkung und Eure Ideen leben. Interesse? Schreib uns an wissenschaftskritik [at] stura.uni-jena.de oder leite diese Information weiter an Leute, die Interesse haben könnten
